Armin Sandig - Ein Blick auf sechs Jahrzehnte Malerei
von
Heinz Spielmann (2009)
Anfänge und ihre Entscheidungen
1949 konnte man im Konstanzer Theater Arbeiten eines bis dahin unbekannten Malers sehen, die den Besuchern fremd erscheinen mussten, selbst den wenigen, die sich in der aktuellen künstlerischen Entwicklung auszukennen glaubten. Sandig zeigte Bilder, die auf eine erst zehn Jahre später sich durchsetzende Malerei gerichtet waren, zu einer Zeit, in der man zunächst das längst Erreichte kennen lernen musste. Es galt zunächst, im Deutschland der ersten Nachkriegsjahre die heute als „klassisch“ bezeichnete Moderne nach ihrer Verfemung wieder zu entdecken. Nur die Älteren besaßen noch Erinnerungen an den frühen Expressionismus, an den „Blauen Reiter“ und das Bauhaus. Was danach gekommen war, verstand kaum jemand. Wie groß Skepsis und Unverständnis blieben, zeigte sich noch 1951; die Stadtväter von Brühl empörten sich über die Bilder von Max Ernst, des heute unbestrittenen großen Sohnes der Stadt, als sie seine Retrospektive sahen - sie hatten ihr ohne die geringste Ahnung von seinen Bildern zugestimmt. Wieder zwei Jahre später musste Willi Baumeister die Moderne gegen ihre Kritiker, vor allem gegen Hans Sedlmayr und dessen Pamphlet „Verlust der Mitte“ verteidigen.
Wie sollten die jüngeren Künstler, die am Ende der Nazizeit gerade 15 -16 Jahre alt waren, zu sich selbst und zu einer eigenen Sprache finden? Sie kannten kaum die Bilder der um 1910 Geborenen, die 1933 etwa so alt gewesen waren wie sie bei Kriegsende. Mit ihnen verband sie die Überzeugung, dass nach dem Verlust aller Normen eine neue Kunst nur aus der völligen Freiheit entstehen könne, dass jeder Einzelne in dieser Freiheit seine Normen selbst finden müsse. Was wir heute „Informel“, also „formlos“ nennen, war letzten Endes nichts anderes als der Versuch, aus der Auflösung von allem, von Gegenstand, Konstruktion, Komposition - also von jeder Verbindlichkeit - zu einer zuvor unbekannten Bildform zu gelangen. Dieser Prozess glich - wie die Entwicklung während der
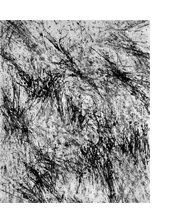 50er Jahre belegt - der Entstehung des Kosmos aus einer nur als Struktur vorhandenen Materie. Gehalt und Beschaffenheit der sich in den fünfziger Jahren entfaltenden abstrakten Malerei sind, wie wir heute klarer erkennen als damals, aus dem Verständnis der Freiheit als unbegrenzte Möglichkeit und aus dem Willen zu begreifen, diese Möglichkeiten aus eigener Kraft zu nutzen, mit dem Ziel, aus ihnen etwas zuvor Unbekanntes zu machen. Kennzeichnenderweise trug das wichtigste Buch eines Malers, das dazu erschien, einen aufschluss-reichen Titel, Willi Baumeisters „Das Unbekannte in der Kunst“. 50er Jahre belegt - der Entstehung des Kosmos aus einer nur als Struktur vorhandenen Materie. Gehalt und Beschaffenheit der sich in den fünfziger Jahren entfaltenden abstrakten Malerei sind, wie wir heute klarer erkennen als damals, aus dem Verständnis der Freiheit als unbegrenzte Möglichkeit und aus dem Willen zu begreifen, diese Möglichkeiten aus eigener Kraft zu nutzen, mit dem Ziel, aus ihnen etwas zuvor Unbekanntes zu machen. Kennzeichnenderweise trug das wichtigste Buch eines Malers, das dazu erschien, einen aufschluss-reichen Titel, Willi Baumeisters „Das Unbekannte in der Kunst“.
Unter den deutschen Malern, die dieses Ziel verfolgten und sich als Vertreter des „Informel“ oder „Tachismus“ mehr schlecht als recht klassifiziert sahen, war Armin Sandig einer der jüngsten. Er kam aus Oberfranken, kannte keine Kunstschule, war Autodidakt, also frei von allen Vorgaben durch Lehrer - eine ideale Kondition für eine voraussetzungslose Malerei. Wie hätte er für sie Verständnis finden können?
Dreißig Jahre nach der Konstanzer Ausstellung, die Sandig in seinen Katalogen stets als erste aufführt, hat er seine Anfänge im Telegrammstil beschrieben: Der mit 16 Jahren gefasste Entschluss, Maler zu werden, allen materiellen Schwierigkeiten und allen Widrigkeiten zum Trotz. Wenn er Geld verdienen musste, schrieb er in der lokalen Zeitung Kunstkritiken, auf die hin es Protestbriefe hagelte. Als er 1946/47 mit einigen Künstler-Kollegen im heimatlichen Hof einige Bilder zeigte, mussten sie lesen „Malern solcher Bilde sollte man die Lebensmittelkarten entziehen“. 1999 freute sich das Schweinfurter Museum, dass es eines der ein halbes Jahrhundert zuvor beschimpften Blätter als Geschenk für seine
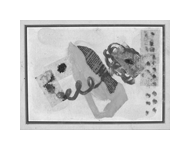 Sammlung erhielt. Es handelt sich um eine Collage von 1948/49 mit einer farbigen Struktur, eine Vorahnung von dem, was Sandig zehn Jahre später bekannt machen sollte. Sammlung erhielt. Es handelt sich um eine Collage von 1948/49 mit einer farbigen Struktur, eine Vorahnung von dem, was Sandig zehn Jahre später bekannt machen sollte.
Vom fränkischen Hof ging Sandig zunächst nach München. Autodidakt blieb er nicht freiwillig, sondern nur, weil er bei dem gerade an die Akademie berufenen Xaver Fuhr studieren wollte, Fuhr jedoch nicht das Wohlwollen des ebenso reaktionären wie mächtigen Kultusministers mit dem treffenden Namen Hundhammer fand - also wurde es nichts mit dem Studium. Vielleicht führte diese Abweisung den jungen Maler schneller zu sich selbst - und 1951 nach Hamburg. Zwar auch in Stuttgart, Düsseldorf und anderswo in Westdeutschland 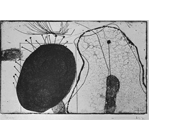 präsentiert, fand er in der Hansestadt eine ihn tragende Liberalität. Von hier aus machte er bald von sich reden, besonders mit seinen Radierungen. präsentiert, fand er in der Hansestadt eine ihn tragende Liberalität. Von hier aus machte er bald von sich reden, besonders mit seinen Radierungen.
Frühe Bilder und Blätter
1959, zwei Jahre nachdem die Hamburger Kunsthalle ihn ausgestellt hatte, legte Armin Sandig druckgraphische Blätter vor, mit denen er zum Begriff wurde. Über sie schrieben Max Bense und Helmut Heissenbüttel, Will Grohmann und Alfred Henzen. Welche angeseheneren Interpreten hätte ein junger Maler damals finden können? Er war knapp 30 Jahre alt, sah sich aber bereits in den neuesten enzyklopädischen Publikationen moderner Kunst erwähnt. Er machte Eindruck; beim Nachlesen der ersten Interpretationen bemerkt man jedoch eine gewisse Unsicherheit der Rezensenten gegenüber dem Ungewohnten. Will Grohmann etwa blieb allgemein: „…es war alles schon vor uns da, wir bemerkten es nur nicht, nun da es der Maler sieht, sehen wir es auch.“ Der Satz bezieht sich auf eine Mappe mit fünf Radierungen, die den Titel 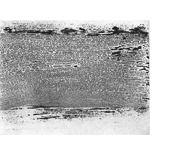 „Landstriche und Seestücke“ trug. Eine der nächsten, die folgen sollten, hieß „Deklination der Aquatinten“. Beide Radierfolgen zeigen Strukturen, horizontal gereihte oder vertikal verlaufende. Sie wecken gegenständliche Assoziationen. Die einen erinnern an Landschaften mit flachen Hügeln und Bäumen, die anderen an sprießende Halme, wieder andere, aus zarten Linienbüscheln bestehende, wecken Vorstellungen von Gesichtern und Torsi. Für alle gilt: Aus Strukturen entsteht Natur, eine gegenständliche Welt. „Landstriche und Seestücke“ trug. Eine der nächsten, die folgen sollten, hieß „Deklination der Aquatinten“. Beide Radierfolgen zeigen Strukturen, horizontal gereihte oder vertikal verlaufende. Sie wecken gegenständliche Assoziationen. Die einen erinnern an Landschaften mit flachen Hügeln und Bäumen, die anderen an sprießende Halme, wieder andere, aus zarten Linienbüscheln bestehende, wecken Vorstellungen von Gesichtern und Torsi. Für alle gilt: Aus Strukturen entsteht Natur, eine gegenständliche Welt.
Diese frühen Blätter Armin Sandigs vertreten ein Prinzip, das auch andere Vertreter des Informel stimulierte und das Max Bense „Quasi-Gegenständlichkeit“ nannte. Das serielle Verfahren ließ aus dem Zufall Ordnung, aus Ordnung ein gleichnishaftes Abbild werden. Es blieb dem Betrachter in aller Freiheit überlassen, dieses Gleichnis zu deuten; Sandig regte dessen Phantasie durch poetische Titel an. Sie lauten etwa „Mondkalb und Kälbin“, „Widerspenstige Hostie“ oder „Kleines französisches Unglück“. Jürgen Schulze, der unter Günter Busch in der Bremer Kunsthalle eine Auswahl von Sandigs Gemälden des Jahrzehnts von 1959 bis 1969 präsentierte, sprach vom „Träumerischen“ dieser Bildwelt und davon, dass in ihr aus dem Prinzip der Formlosigkeit Formprinzipien würden. Eine solche Dialektik des Seriellen fand ihren adäquaten Interpreten in Helmut Heissenbüttel, dessen „konkrete Poesie“ demselben Prinzip huldigte. Es sollte sich in Armin Sandigs Lebenswerk bis heute als tragfähig erweisen.
Landschaftsparaphrasen
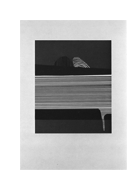 Als die Bremer Kunsthalle 1980 erneut eine Ausstellung Armin Sandigs zeigte, dieses mal mit Arbeiten der siebziger Jahre, kommentierte er sie mit eigenen Worten und mit Postulaten, die er an sich selbst richtete. Das erste davon lautete: „Keine Imitation gemalter Bilder“. Die anderen enthalten Bekenntnisse zur Linie als dem wichtigen und mannigfaltigen Element des Bildes. Von Verbindungen der Linie zur sichtbaren Welt ist nicht die Rede. Das knappe Statement, die Zurückweisung von Imitation ist - wohl bewusst - doppeldeutig. Man kann es verstehen als Verbot der Nachahmung von anderen Bildern, aber auch als Verbot der Nachahmung von Natur im Bild. Als die Bremer Kunsthalle 1980 erneut eine Ausstellung Armin Sandigs zeigte, dieses mal mit Arbeiten der siebziger Jahre, kommentierte er sie mit eigenen Worten und mit Postulaten, die er an sich selbst richtete. Das erste davon lautete: „Keine Imitation gemalter Bilder“. Die anderen enthalten Bekenntnisse zur Linie als dem wichtigen und mannigfaltigen Element des Bildes. Von Verbindungen der Linie zur sichtbaren Welt ist nicht die Rede. Das knappe Statement, die Zurückweisung von Imitation ist - wohl bewusst - doppeldeutig. Man kann es verstehen als Verbot der Nachahmung von anderen Bildern, aber auch als Verbot der Nachahmung von Natur im Bild.
Das eine Verdikt versteht sich wohl für jeden Künstler von selbst, der etwas auf sich hält, das andere richtet sich gegen die realistische Darstellungsmodalität. Abgesehen davon, dass Sandig diese durchaus beherrscht - wie seine Aktzeichnungen belegen - bedeutet die Ablehnung der Imitation nicht den Verzicht auf das Naturerlebnis. Armin Sandig hat es immer wieder gesucht, vor allem das Erlebnis der Landschaft, regelmäßig auf Reisen während der Sommermonate im Süden Europas, im Norden vor allem an den Küsten. Selbst während der Jahrzehnte, in denen er einen großen Teil seiner Zeit den Aufgaben der Freien Akademie widmete, verzichtete er nicht auf Reisen in Regionen, die ihn inspirierten. Während dieser Reisen entstehen vor Ort meist Aquarelle, die den Augeneindruck in eine abstrakte Metapher übersetzen.
Nur mittelbar lässt sich aus den Titeln schließen, wo sie gemalt wurden. Man ahnt den Süden, wenn man „Hügel der großen Melonen“ oder „Weinlaube in Astros“ oder „Saracenenturm“ liest, aber eine bestimmte Topographie lässt sich aus solchen poetischen Hinweisen nicht ableiten. Südlich nehmen sich auch die orthogonal angeordneten Bildelemente vieler Blätter aus, sie erinnern an die kubischen Architekturen der Mittelmeerländer als pièce de résistance der Ordnung einer Landschaft mit wellenförmigen Hügeln, mit spärlich bewachsenen Hängen, mit Küstenhorizonten. Unwillkürlich stellen sich, auch ohne die Bildtitel, Assoziationen an solche Landschaftsformationen oder an die für sie charakteristischen Architekturen ein.
 Die Formationen von Sandigs Landschaften wachsen aus Strukturen kleinster Partikel, die sich verdichten und dadurch die Vorstellung von Dünen oder Steppen, Baumwuchs oder Ufern, Wegen oder Flußläufen wach rufen. Sie entstehen also nicht durch Nachahmung, sondern durch eigenständig verwendete, abstrakte Bildelemente. Selbst beim Malen im Freien geht es Sandig bei der Entstehung seiner Aquarelle primär um die konstituierenden Elemente des Bildes, um Linie und Fläche, organische oder geometrische Ordnung, Kolorit und Farbklänge; nur bedingt beschäftigt ihn die gegenständlich-topographische Situation, die er vor Augen hat. Assoziationen an die wirkliche Welt ergeben sich beiläufig, nicht reflektiert, also naiv. Sie steuern mittelbar das Resultat, das der Titel als frei zu begreifende Ikonographie andeutet. Die Formationen von Sandigs Landschaften wachsen aus Strukturen kleinster Partikel, die sich verdichten und dadurch die Vorstellung von Dünen oder Steppen, Baumwuchs oder Ufern, Wegen oder Flußläufen wach rufen. Sie entstehen also nicht durch Nachahmung, sondern durch eigenständig verwendete, abstrakte Bildelemente. Selbst beim Malen im Freien geht es Sandig bei der Entstehung seiner Aquarelle primär um die konstituierenden Elemente des Bildes, um Linie und Fläche, organische oder geometrische Ordnung, Kolorit und Farbklänge; nur bedingt beschäftigt ihn die gegenständlich-topographische Situation, die er vor Augen hat. Assoziationen an die wirkliche Welt ergeben sich beiläufig, nicht reflektiert, also naiv. Sie steuern mittelbar das Resultat, das der Titel als frei zu begreifende Ikonographie andeutet.
Die Entfaltung dieser Ikonographie lässt sich in der Bild-Auswahl dieser Publikation vor allem an Beispielen aus den 90-er Jahren verfolgen. Am Anfang der Reihe, die der Maler selbst nicht nach diesem Prinzip anordnete, die sich jedoch der Betrachter unschwer zusammen stellen kann, stehen Agglomerate einer kleinteiligen, farbigen Materie, etwa in „Sternbild“ von 1994; diese Materie verdichtet sich wie in dem zwei Jahre später gemalten „So blau“, strukturiert sich entlang der Horizontlinien und Wegführungen - „Stoppelfelder“, „Küstenlauf“, beide 1990; „Wegwarte“, 1996. Schließlich verfestigt sie sich zu geometrischen Formen, die Vorstellungen von Häusern und Dörfern wecken.
Die Titel formuliert Sandig in der Regel erst, wenn ein Bild fertig ist, als poetisch-spielerische Metapher, die dem Verständnis eine Tür öffnet, aber nicht alles beschreibt, was man von dem geöffneten Tor aus sehen kann.
Köpfe und Figuren
Während der 90-er Jahre dominierten unter Sandigs Bildern die Landschafts-Assoziationen. Gegen Ende dieser Werkphase tauchen mehr und mehr Köpfe und Figuren, dann auch Figurengruppen auf. Die Köpfe, die am Anfang dieser Reihe stehen, bilden sich wie die Landschaften aus kleinen Partikeln, aus Spritzern, Punkten, Flecken, kurzen Linien. Sie gleichen in ihrer Form unentschiedenen Verdichtungen von Materie im Kosmos, aus denen sich Augenpunkte sowie Andeutungen von Nasen oder Mündern abheben. Man könnte sie in Anlehnung an Leibniz Monaden nennen, als sich selbst genügende Lebewesen, die für sich bestehen, ohne Bezug zu anderen. Ihre Morphologie bleibt unbestimmt. Sie befinden sich am Beginn ihrer Existenz, aus ihnen kann etwas werden, was uns unbekannt ist und uns überrascht. „Verkörperungen“ oder „Gesichtszüge“ heißen die Titel dieser Bilder. Sie stellen uns eine mögliche, von unserer realen verschiedene Welt vor, deren Beschaffenheit wir mehr aus dem Blick ins Mikroskop als aus unserer vertrauten Umgebung erschließen können. Die zunächst noch vagen Gesichter erhalten zu Beginn der frühen neunziger Jahre festere, individuellere Züge, bis hin zu einem ernst und entschlossen blickenden „Missionar“  und einem 1993 gemalten „Selbstporträt“. Es kann nur in einem übertragenen Sinn als obligates Portrait gelten. Typus, Ausdruck, Deutung des Ich sind dem Maler wichtiger als Ähnlichkeit, und doch verraten die beiden Augen, die zu zwei verschiedenen Gesichtern gehören könnten, sowie der zusammen gepresste Mund mehr von ihm selbst, als er gemeinhin zu erkennen gibt. So blickt ein Skeptiker, dessen Vorbehalte leicht in Sarkasmus oder Ironie umschlagen können, wie die Figurenbilder und -szenen belegen. und einem 1993 gemalten „Selbstporträt“. Es kann nur in einem übertragenen Sinn als obligates Portrait gelten. Typus, Ausdruck, Deutung des Ich sind dem Maler wichtiger als Ähnlichkeit, und doch verraten die beiden Augen, die zu zwei verschiedenen Gesichtern gehören könnten, sowie der zusammen gepresste Mund mehr von ihm selbst, als er gemeinhin zu erkennen gibt. So blickt ein Skeptiker, dessen Vorbehalte leicht in Sarkasmus oder Ironie umschlagen können, wie die Figurenbilder und -szenen belegen.
Als Korrektiv seiner Phantasie und als Voraussetzung seiner psychologischen Deutung von Physiognomien trainiert Armin Sandig sein Sehen an lebenden Modellen, was kaum bekannt ist. Wer kennt schon seine umfangreichen Folgen von Aktzeichnungen?
 Sie gehen ihm ganz offensichtlich leicht von der Hand, erscheinen so schwerelos wie die zarten Lineaturen von Sandigs Frühwerken und Landschaften, unterscheiden sich, was die künstlerische Handschrift betrifft, kaum von diesen, ausgenommen ihre Realitätsnähe. Dem Maler und Zeichner bedeuten sie vielleicht nicht mehr als Exerzitien. Sie liefern jedoch nicht nur den Beweis, dass er sein Metier im gängigen Sinn durchaus beherrscht, sie geben auch zu erkennen, dass für ihn die Ausstrahlung der menschlichen Gestalt vor allem erotisch ist. Sie gehen ihm ganz offensichtlich leicht von der Hand, erscheinen so schwerelos wie die zarten Lineaturen von Sandigs Frühwerken und Landschaften, unterscheiden sich, was die künstlerische Handschrift betrifft, kaum von diesen, ausgenommen ihre Realitätsnähe. Dem Maler und Zeichner bedeuten sie vielleicht nicht mehr als Exerzitien. Sie liefern jedoch nicht nur den Beweis, dass er sein Metier im gängigen Sinn durchaus beherrscht, sie geben auch zu erkennen, dass für ihn die Ausstrahlung der menschlichen Gestalt vor allem erotisch ist.
Was die Aktzeichnungen trotz der oft provokanten Haltung der Modelle zurückhaltend zu erkennen geben, gewinnt in Sandigs Figurenbildern der letzten eineinhalb Jahrzehnte an Direktheit, bis an die Grenze von Satire und Karikatur, wenn etwa in „Flitterwochenträumen“ große phallische Gebilde in den Raum vorstoßen oder ausgestreckte Leiber in einer „Sadomachie“ von gierigen Akteuren verschlungen werden.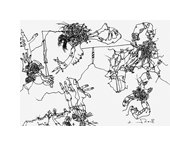
Man kann Sandigs Verständnis des Eros kaum als verführerisch bezeichnen. Für ihn bleibt er eine drastische, eruptive, unkontrollierbare, auf Zerstörung und Auflösung gerichtete Energie. Seine Gruppenbilder machen seine Wildheit gegenwärtig. Dieser Eros besitzt eine dionysische, keine apollinische Natur, und Aphrodites Ideal entsprechen die Leiber, ihre Gesten und Gebärden durchaus nicht. Eine ungezügelte Wildheit spricht selbst noch aus einigen wie im Schock erstarrten Figuren. Ihre „Balzrituale“ gleichen mehr einem sacre de printemps als einem fröhlichen Vogelgezwitscher.
Wie makaber die Ironie von Sandigs Gestalten sich äußern kann, zeigt sich vor allem an einigen Gruppen-szenen, denen die Bildgestalten ebenso wie Maler und Betrachter als Voyeure zuschauen. Meist stehen mehrere Gestalten um eine hilflose, nackte weibliche Figur herum; sie ist gefesselt und betäubt, ein zu keiner Aktion fähiges Opfer. Die Bildtitel deuten den Sadismus der Szenerien nur an, lauten „Operation“ (s. rechts), „Melisande“ oder, noch apokrypher, „Oswald von Wolkenstein in meinen Träumen“. Man denkt unwillkürlich an Dalis Festdiners, auf deren Tafel eine nackte junge Frau lag, oder, noch ridiculer, an die englischen Diners wohlsituierter Gentlemen des frühen 19. Jahrhunderts, die dem Öffnen einer ägyptischen Mumie vorausgingen.
In der makabren Ironie seiner Figurenbilder formuliert Sandig eine subtile, substantiell sehr scharfe Gesellschaftskritik. Sie äußert sich auch in der seltsamen Schwerelosigkeit der Gestalten, denen jede Bodenhaftung fehlt. Sie befinden sich in ständigem Schwebezustand, sind „Abgehoben“ in der direkten, visuell wahrnehmbaren Bedeutung des Wortes, fliegen im „Deckenbild Barock“ bis an die Decke als die ekstatischen Wesen einer desolaten Welt, begeben sich, was kaum bekannt ist, auf „Himmelsturz und Höllenfahrt“, was für sie kaum noch einen Unterschied ausmacht.
Linien und Farben
Von den frühen Strukturierungen der vor fünf Jahrzehnten edierten Radierfolgen zu den neueren und neuesten Bildern Armin Sandigs führt eine ausgedehnte, konsequente Entwicklung. In ihr dominiert die Linie. Für den Katalog seiner Bremer Ausstellung notierte der Maler 1980, was alles die Linie umschließe: Bewegung, Verlauf, Richtung, Grenzziehung, Kontur, Modulationen von Stärke und Länge, von Schatten und Licht. Ob mit ihr Gegenständliches umschrieben oder eine von gegenständlichen Assoziationen freie Struktur fixiert werde, sei, so schrieb er, sekundär. Die Linie sieht er nicht nur als „Grundlage jeder Art von Zeichnung“, sondern als den bestimmenden Faktor aller seiner Bilder. In den Landschaftsparaphrasen erscheint sie als Struktur, als Horizont, als Wegmarke, als Begrenzung von Architektur, in den Köpfen besitzt sie eine signetartige Funktion, in den Figuren bestimmt sie die Körperumrisse. Fast immer trägt sie ein zarter, kalligraphischer Duktus, der den Farbklängen Halt gibt.
Der Leichtigkeit von Sandigs Linienzeichnung entspricht das Kolorit. Immer bleibt es pastellartig hell. Kräftigere Töne sind auf kleine Zonen und Partien beschränkt, auf diese Weise - durch den Gegensatz - heben sie das unschwer-Transparente des Farbklangs hervor. Um diese Transparenz zu gewährleisten, malt Sandig seit Jahrzehnten vorwiegend mit Aquarell, Tempera und Acryl. Selbst, wenn er früher - bis etwa 1980 - Ölfarbe benutzt, trägt er sie so dünn auf, dass sie dem Aquarell nahe kommt.
Die Palette umfasst die gesamte Tonskala, aber unverkennbar gibt es darin zwei Farben, die fast immer den Klang bestimmen: Hellblau und Weiß. Das Weiß wird oft zur lichtesten Spielart von Blau, der Farbe von Himmel und Wasser, der Schwerelosigkeit und des Schwebens. Gelb changiert durch einen Hauch von Blau etwas grünlich, Rot spielt durch Blau ins Violette. Die Bilder einer Ausstellung machen das Blau zu einer Folie, die Alles trägt, Allem die Luft und den Atem gibt, Alles wie selbstverständlich erscheinen lässt. Sandigs Blau ist die Farbe seiner Ironie, sie nimmt dem Ernst das Pathos, verwandelt Realität in Traum.
Worte
Vor zehn Jahren erwähnte Armin Sandig in autobiographischen Notizen über seine frühen Jahre: „Ach, die Verrücktheiten der Jugend: tagsüber gemalt, nachts bis zum Morgengrauen und Nesselfieber geschrieben. Gedichte und ein dickleibiger, selbstillustrierter Roman. Man war eben ein Genie! - und war man’s nicht, so musste man sich eben dazu durchringen...“ Solche Notizen belegen nicht nur, dass die Ironie des Malers gegenüber sich selbst nicht ausgeblendet wird, sie deuten auch darauf hin, dass ihm das Wort in eigener Sache als Chance des Ausdrucks durchaus zur Verfügung steht. Ohne diese Möglichkeit hätte er schwerlich seine poetischen Titel gefunden, die der Phantasie des 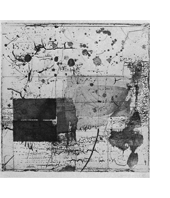 Betrachters eine Tür öffnen, ohne sie hätte er schwerlich die zweite große, ihn seit fast drei Jahrzehnten fordernde Aufgabe als Präsident der Freien Akademie der Künste erfüllen können. Dass und wie ihm das Wort zur Verfügung steht, merkt man etwa, wenn er über den Gründer und ersten Präsidenten der Akademie, den Schriftsteller Hans Henny Jahnn spricht oder wenn er kritisch zu Fragen der Kunst oder der Kunstszene Stellung nimmt. Zwar hält er sich, was die eignen Bilder betrifft, an die Maxime „Bilde Künstler, rede nicht“, aber deutet er nicht mit jedem Titel eine der Möglichkeiten an, wie man ein Bild verstehen könne, als eine Offerte der Freiheit für die Augen. Betrachters eine Tür öffnen, ohne sie hätte er schwerlich die zweite große, ihn seit fast drei Jahrzehnten fordernde Aufgabe als Präsident der Freien Akademie der Künste erfüllen können. Dass und wie ihm das Wort zur Verfügung steht, merkt man etwa, wenn er über den Gründer und ersten Präsidenten der Akademie, den Schriftsteller Hans Henny Jahnn spricht oder wenn er kritisch zu Fragen der Kunst oder der Kunstszene Stellung nimmt. Zwar hält er sich, was die eignen Bilder betrifft, an die Maxime „Bilde Künstler, rede nicht“, aber deutet er nicht mit jedem Titel eine der Möglichkeiten an, wie man ein Bild verstehen könne, als eine Offerte der Freiheit für die Augen.
So gut er das Wort auch beherrscht, er bleibt doch in erster Linie ein Maler, wie sein Werk nunmehr seit sechs Jahrzehnten beweist.
|
|

Abgehoben
2008, 100cm x 120cm,
Acryl auf Leinwand

Kreislauf: die Wiederkehr des Gleichen
2005, 100cm x 100cm,
Acryl auf Leinwand

Wirr wo so
1998, 65cm x 50cm,
Aquarell

Porträt
2006, 60cm x 50cm,
Acryl auf Leinwand

Gelassenes Ding
1993, 65cm x 50cm,
Aquarell mit Collage
 Griechischer Indianer Griechischer Indianer
1990, 65cm x 50cm,
Aquarell

Erleuchtete
1995, 65cm x 50cm,
Aquarell mit Deckweiß

Traum-piscine
1995, 65cm x 50cm,
Aquarell mit Collage

Mit Standuhr
2005, 80cm x 100cm,
Acryl auf Leinwand

Auf Naxos
2007/8, 80cm x 100cm,
Acryl auf Leinwand

Idylle
2007/8, 80cm x 100cm,
Acryl auf Leinwand

Kopf
1987, 70cm x 50cm,
Acryl auf Papier

Operation
1979, 100cm x 100cm,
Öl auf Leinwand

Gruß an Korsika
1997, 65cm x 50cm,
Aquarell mit Collage

Badeleben mit Sonne und Hagel
1995, 65cm x 50cm,
Aquarell

Mit rotem Kopf
1995, 65cm x 50cm,
Aquarell mit Deckweiß
|